
Architektonische Sommerlektüre
Vom "Portugiesischen Haus" über italienische Ruinen bis zur Lübecker Altstadt: Diese sechs Bücher aus unserer Reihe Grundlagen empfehlen wir Ihnen fürs Reisegepäck und für laue Leseabende.
Abbildung: Raúl Lino wählte die Zypresse zu seinem Zeichen, bezugnehmend auf ein Zitat des persischen Dichters Scheich Saïd: »Besitzt du im Überfluss, sei freigiebig wie der Dattelbaum. Wenn du nichts deinen Besitz nennst, dann sei ein Azad, ein freier Mann wie die Zypresse.«
1. Portugal
Er gehört zu den interessantesten Persönlichkeiten der portugiesischen Baugeschichte: Raúl Lino da Silva (1879–1974) entwarf vor allem Wohnhäuser, für die er regionale Traditionen mit innovativen Strömungen aus West- und Mitteleuropa verband. Als junger Mann besuchte er die Kunstgewerbeschule in Hannover und blieb Zeit seines Lebens eng mit Deutschland verbunden. In unserem Buch Zwischen regionaler Moderne und portugiesischem Stil wird die Biografie dieses so vielseitig begabten wie umstrittenen Mannes nachgezeichnet. Ausführlich werden Linos wichtigste Schriften und das von ihm propagierte Ideal des »Portugiesischen Hauses« vorgestellt.
2. Spanien
Die Diktatur des Generals Francisco Franco hinterließ in Spanien auch architektonisch tiefe Spuren. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg standen die ländlichen Gebiete im Fokus des national-katholischen Regimes. Eine neue Generation von Architekten suchte damals nach einer abstrahierten ländlichen Architektur und einer organischen, mit der Landschaft verschmolzenen Stadtform. Das Buch Rural Utopia and Water Urbanism stellt die Strategie hinter der Gründung von 300 Dörfern ("Pueblos") vor und zeigt, welche Rolle dabei Dämme, Bewässerungskanäle und Elektrizitätswerke spielten.
3. Italien
Ruinen gehören seit jeher zu europäischen Städten, sei es als Überreste alter Reiche oder als Folge von jüngeren Ereignissen wie Bränden oder der Stilllegung von Industrieanlagen. Wie umgehen mit ihnen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Buches Urban Ruins. Die Denkmalpflegerin Elisa Pilia untersucht darin den Umgang mit urbanen Ruinen am Beispiel des historischen Zentrums von Cagliari. In der Hafenstadt an der Südküste Sardiniens wurden während des Zweiten Weltkriegs viele Gebäude durch Luftangriffe der Alliierten zerstört. Ausgehend von ihrer Analyse zeigt Pilia Strategien zum Schutz und zur Neunutzung von Ruinen überall in Europa.
4. Finnland
In seiner Heimat gilt er als "Meister des Betons": Pekka Pitkänen (1927–2018) war einer der bedeutendsten finnischen Architekten der Nachkriegszeit. Bekannt ist er vor allem für den Erweiterungsbau des finnischen Parlaments (1978) und die Heilig-Kreuz-Kapelle (1967) in Turku. Für Concrete Modernism hat der Turkuer Autor Mikko Laaksonen umfangreiche Archivrecherchen angestellt, Interviews geführt und sich in Pitkänens unveröffentlichte Memoiren vertieft. Seine Monografie – das erste Buch dieser Art auf Englisch – bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben und Schaffen eines ungemein produktiven, aber erstaunlich wenig bekannten Architekten.
5. Deutschland
Kaum ein Ereignis hat Lübeck in der jüngeren Geschichte so sehr geprägt wie die Luftangriffe im März 1942. Die Erzählung über den Zweiten Weltkrieg konzentriert sich deshalb meist auf die Altstadt, die inzwischen zum UNESCO-Welterbe gehört. Unbeachtet bleiben dabei die für Zwangsarbeiter und, nach Ende des Kriegs, für die Unterbringung der Vertriebenen genutzten Lager und der spätere Siedlungsbau außerhalb des Stadtkerns. 90.000 Vertriebene fanden in der Hansestadt schließlich ein neues Zuhause. Heimat auf Trümmern zeichnet anhand ausgewählter Dokumente sowie zahlreicher historischer und aktueller Bilder die Planungsgeschichte der Stadt nach.
6. Brasilien
Posthume Ehre: Im vergangenen Jahr wurde Brasiliens bekannteste Architektin Lina Bo Bardi (1914–1992) für ihr Lebenswerk mit einem Goldenen Löwen der Architekturbiennale von Venedig ausgezeichnet. Die gebürtige Italienerin steht im Mittelpunkt von Richard Zemps Buch Bauen als freie Arbeit, in dem es um die brasilianische Architektur zwischen 1961 und 1982 geht. Wie die Grupo Arquitetura Nova, die ebenfalls Gegenstand von Zemps Untersuchung ist, war Bo Bardi bestrebt, die Trennung zwischen Entwurfsplanung und handwerklicher Umsetzung auf der Baustelle so weit wie möglich aufzuheben.



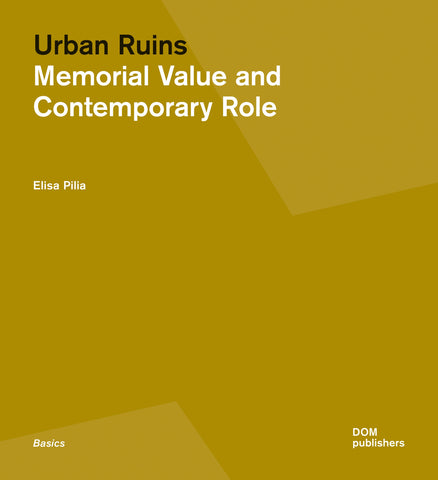














 Strengthening climate resilience in Central Vietnam trough nature-based solutions: Vertical green elements will create a shady and cool public space for school children and residents on hot days. © GCLH
Strengthening climate resilience in Central Vietnam trough nature-based solutions: Vertical green elements will create a shady and cool public space for school children and residents on hot days. © GCLH
